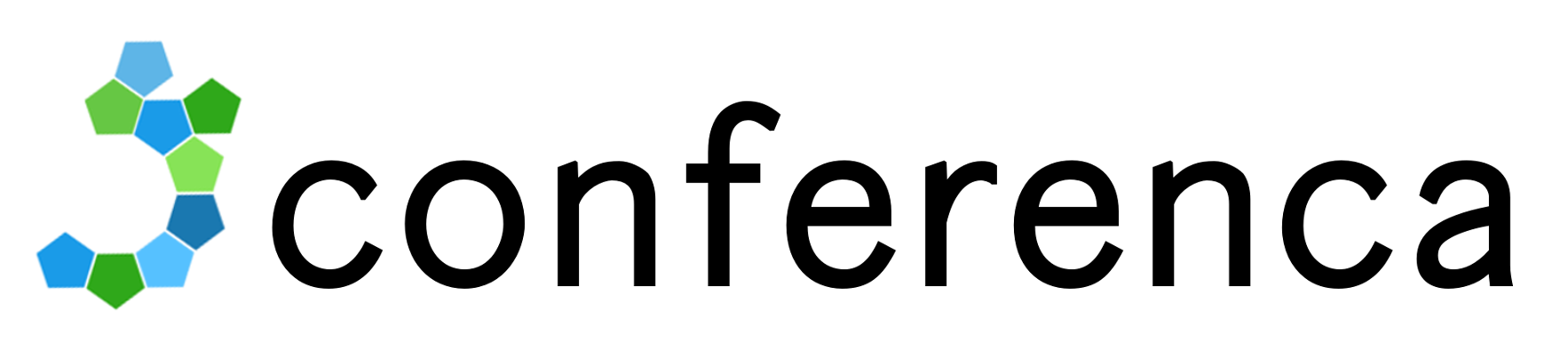Videokonferenzen führen zu stärkerer Ermüdung, schreibt Michael Moorstedt in der „Süddeutschen Zeitung“. Die Akzeptanz von Technik nehme ab einem gewissen Grad von simulierter Authentizität ab. Die Menschen seien durch das eigene Webcam-Bild „zu gleichen Teilen beobachtendes Subjekt und Objekt der Beobachtung“ – anders als bei analogen Konferenzen.
Wer braucht schon noch die Welt da draußen? Nicht wir, sagen die Organisatoren von Preisverleihungen und Festspielen in einer Mischung aus Trotz und Pragmatismus und verkünden stolz, dass ihre Veranstaltungen in diesem Jahr vollständig digital stattfinden. Videokonferenzen werden die Begegnung in Person ersetzen.
Nach fünf Wochen der Selbstisolation scheint die Begeisterung über Videokonferenzen jedoch deutlich nachzulassen
Für den postmodernen Wissensarbeiter ist die Corona-Pandemie der ungebetene Beweis dafür, wie sehr wir uns im Laufe der letzten Jahre schon zu virtuellen Wesen gewandelt haben. Die Technologie in Form von Zoom, Skype und Whatsapp verhilft dem Menschen einmal mehr dazu, nervige biologische Zwänge zu überwinden.
Nach fünf Wochen der Selbstisolation – oder sind es sechs? – scheint die Begeisterung der Menschen darüber jedoch deutlich nachzulassen. Wer schon mal sechs Stunden am Tag in wechselnden Videokonferenzen saß oder bereits zum x-ten Mal zu einem virtuellen Trinkgelage eingeladen wurde, kennt das Gefühl. Weil der Mensch der Gegenwart ja hinlänglich Erfahrung mit Überforderungszuständen hat, gibt es auch bereits einen Namen für die neue Dysfunktion: Zoom Fatigue – benannt nach der Software, deren Nutzerzahl von zehn Millionen im vergangenen Dezember auf mehr als 300 Millionen angestiegen ist.